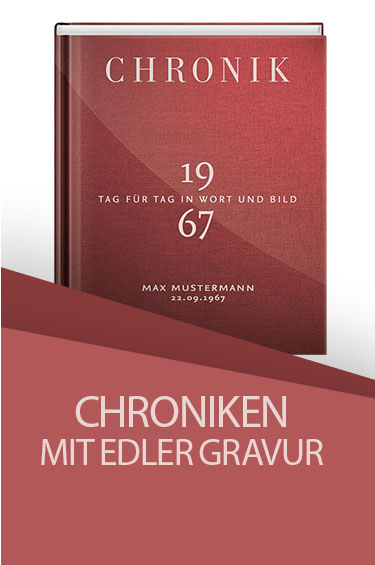Technische Perfektion kennzeichnet die herausragenden Architekturen des Jahres 2000, wobei Museumsneubauten und Bürogebäude besonders auffallen.
Bei den Bürobauten steht vielfach die Natur Pate: Der Braun-Verwaltungsbau in Kronberg bei Frankfurt am Main, ein Werk von Michael Schumacher und Till Schneider, ist ein schlichter Kubus. Seine Raffinesse erhält er dadurch, dass Dach und äußere Glashaut auf die Außentemperatur reagieren und sich an warmen Tagen öffnen - Assoziationen zum Vogelgefieder bieten sich an. Das zwölfstöckige Bürogebäude, das Bothe/Richter/Teherani (BRT) an den Heidenkampsweg in Hamburg gestellt haben, besteht aus sieben Meter hohen Gärten und zweigeschossigen Büroeinheiten, die im Wechsel aufeinandergeschichtet sind; es verwirklicht so die Idee einer »gestapelten Gartenstadt« (Niklas Maak).
Unter den Museumsbauten bietet das neue Wallraf-Richartz-Museum in Köln, das sich im Herbst 2000 einen Tag lang noch ohne Sammlung präsentiert (Eröffnung: Januar 2001), wohl die wenigsten Überraschungen. Oswald Mathias Ungers hat auch in diesem Bau seiner Leidenschaft für das Raster-Quadrat nachgegeben; das Ergebnis wirkt von außen nüchtern; im Innern überzeugt die klare Gliederung mit aneinandergereihten, in große zentrale Räume mündenden Kabinetten.
Der Bau des Neuen Museums in Nürnberg, das der Berliner Volker Staab entworfen hat, bietet bereits von außen Einblicke in die Sammlung: Zu einem neu geschaffenen Platz hin öffnet sich die leicht konkav geschwungene gläserne Fassade des Gebäuderiegels. Sie gibt wie durch ein Schaufenster den Blick frei auf die beiden offenen Museumsetagen, ferner auf einen gewaltigen Betonkubus für Auditorium, Foyer und Oberlichtsaal sowie eine Wendeltreppe.
In der Presse wird die Anlage in Nürnberg mit der Freifläche vor dem Centre Pompidou in Paris verglichen - was angesichts der Größenverhältnisse ein wenig übertrieben erscheint. Passender ist dieser Vergleich im Zusammenhang mit dem neu eröffneten Museum Modern Tate in London, durch das sich die britische Hauptstadt, was die moderne Kunst angeht, wieder in eine Reihe mit Paris und New York stellen will. Untergebracht ist das Modern Tate nicht in einem Neubau, sondern in dem monumentalen, seit 1981 stillgelegten Londoner Kraftwerk, einem Klinkerbau von Sir Giles Gilbert Scott aus den 1940er Jahren. Die Schweizer Jacques Herzog und Pierre de Meuron haben mit auf den ersten Blick simplen, aber überzeugenden Mitteln dem düsteren Gebäude mit dem 99 m hohen Kamin und den schmalen Kathedralfenstern eine neue Ausstrahlung gegeben: Sie setzten einen zweigeschossigen Lichtkörper aus Milch- und Klarglas hinter den Schornstein auf das Gebäude und sorgten dafür, dass die Museumsbesucher über eine breite Rampe in das Langschiff des Baus geführt werden. Im Inneren haben Herzog/Meuron die monumentale Halle mit gewaltigen, schwarz lackierten Stahlträgern teils erhalten, teils durch sieben Etagen gegliedert, die über Rolltreppen erschlossen werden. Ein Kontrastprogramm zu dieser ebenso spröden wie einleuchtenden Ergänzung eines Industriedenkmals bietet das Kulturzentrum »The Lowry« in Manchester. Der Brite Michael Wilford hat einen Bau der monumentalen Geste geschaffen, der wie ein Haufen gigantischer Bauklötze erscheint und von Ferne an Frank O. Gehrys Rock-'n'-Roll-Museum EMP in Seattle gemahnt, das der US-Stararchitekt 2000 vollendet: eine lila-silber-golden schimmernde Skulptur aus fünf Trümmerstücken.
Wilford und Gehry sind 2000 auch mit Bauten in Berlins Mitte dabei, die - an den eher strengen Fassaden erkennbar - sichtbar an den Bauvorschriften in der deutschen Hauptstadt leiden.